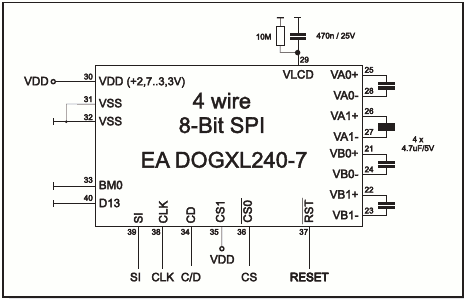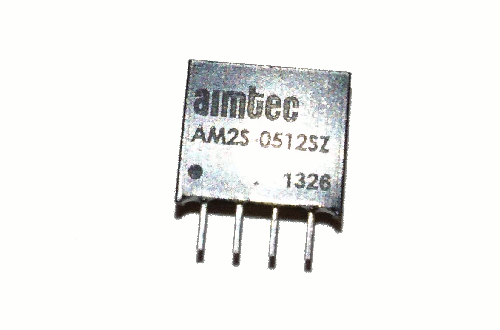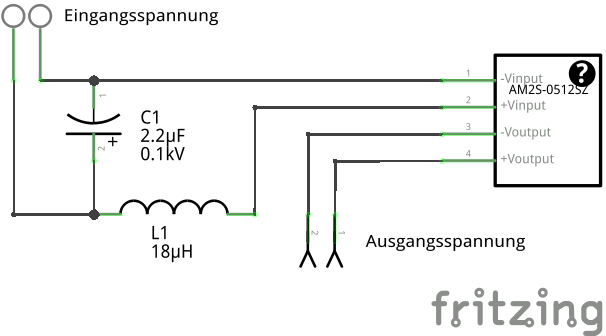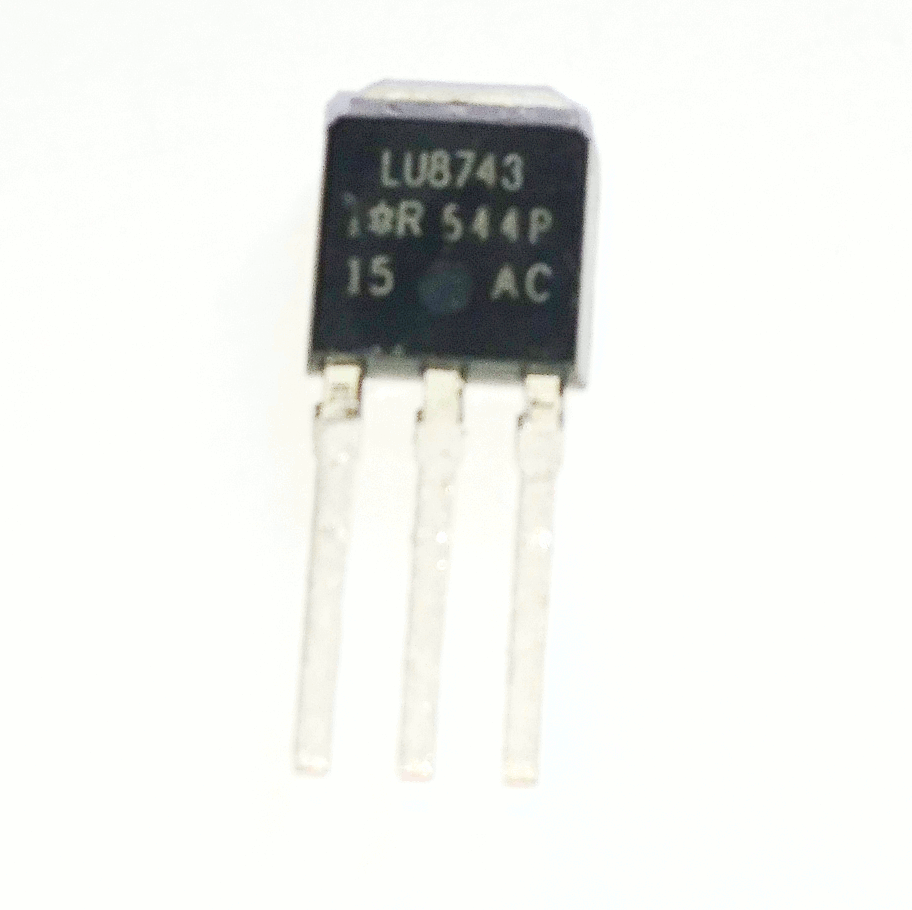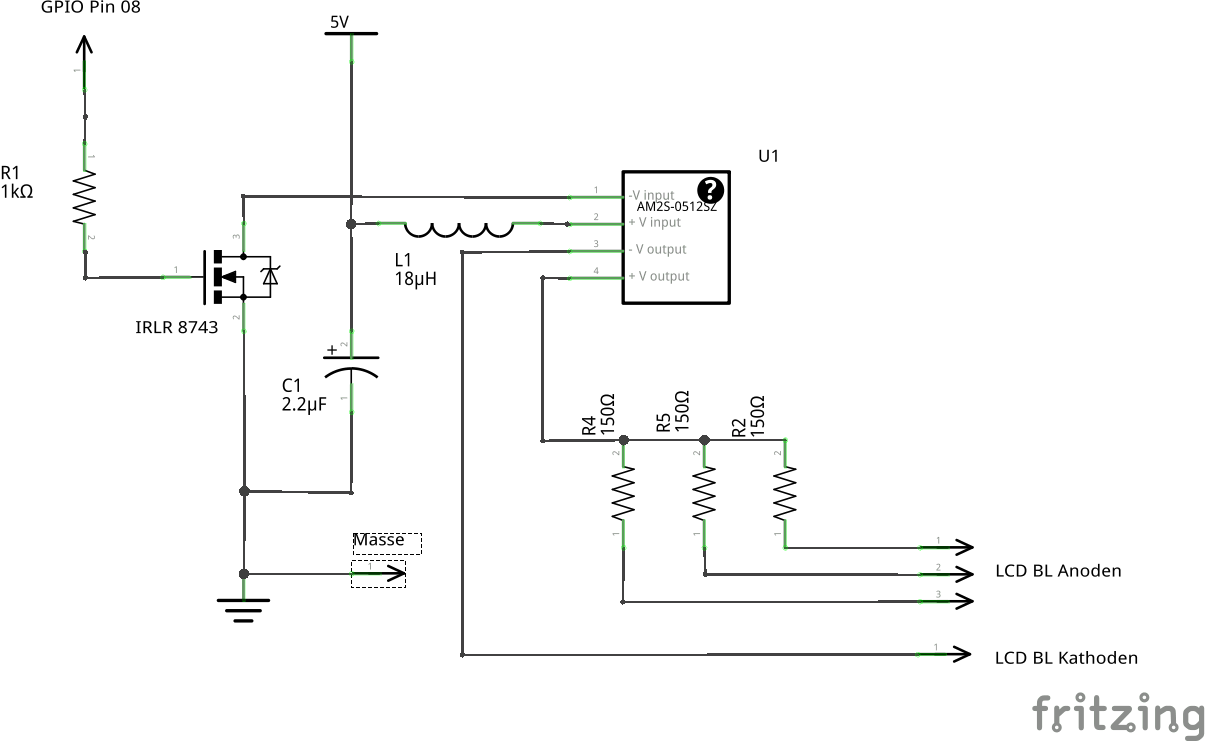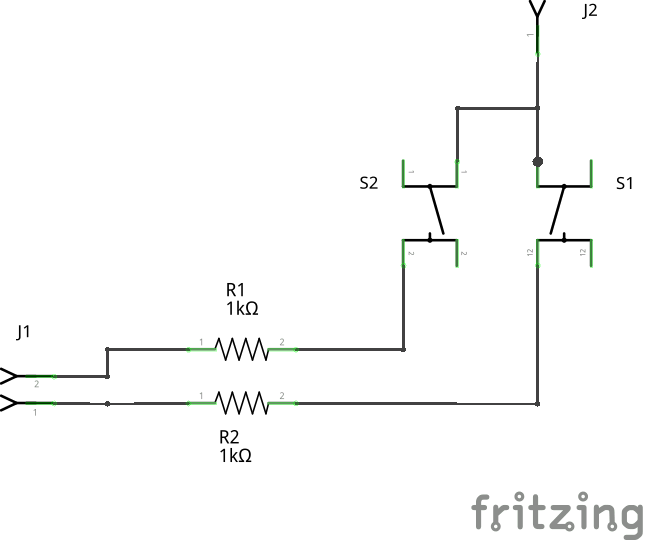|
Linux-Projekte
für den Raspberry Pi, |
Dargestellt
werden soll hier die Ansteuerung eines Grafikdisplays der Firma
'Electronic
Assembly' .
Genauer gesagt, das Modell EA
DOGXL240-7 mit einer Größe von 3,9“.
|
|
Das monochrome LCD-Display : hat eine Auflösung von 240 x 128 Pixeln wird mit 3,3 Volt betrieben hat SPI und I²C Schnittstellen ist im Versandhandel relativ günstig zu erwerben ist das Größte das ich finden konnte
|
Bei
der Programmierung der Schnittstelle mußten
folgende
Punkte beachtet werden:
Das
Display...
… wird
über die SPI-Schnittstelle angesprochen (schneller als I²C) .
Daher ist SPI am Raspberry freizuschalten.
Anleitungen dazu
gibt es genügend im Internet, aber nicht an dieser Stelle.
(Zu
beachten ist, daß bei aktuellen Betriebssystemen
die Freischaltung per Device-Tree erfolgen muß!!!)
...
hat 'von Hause aus' KEINE Hintergrundbeleuchtung.
Diese muß separat erworben und betrieben werden.
(verwendet
man die weiße Beleuchtung, ist diese recht teuer!)
... wird nicht Pixel für Pixel angesteuert, sondern es werden mehrere Pixel pro Byte angesprochen.
... hat KEINE 'Intelligenz'. Jeder Einzelpunkt muß also separat gesetzt/ rückgesetzt werden.
... besitzt KEINE internen Zeichensätze. Diese müssen selbst erstellt werden.
Die Pinbelegung sieht so aus:
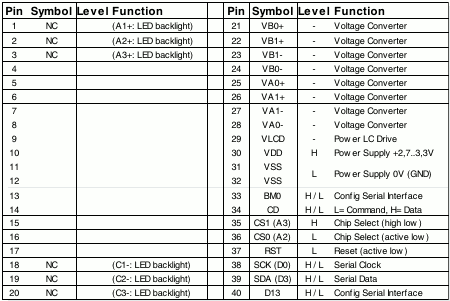
Bildquelle: Electronic Assembly
Das
Modul wird bei der Verwendung der SPI-Schnittstelle wie im
folgenden Schaltplan angegeben beschaltet und mit den angegebenen
Leitungen an den RaspberryPi angeschlossen:
|
|
Der
Anschluß C/D (Command/ Data) wurde willkürlich auf GPIO-Pin
22 gelegt. CLK = Clock (SCLK) CS = ChipSelect (CS_0) RESET nicht belegt
|
Hintergrundbeleuchtung
ACHTUNG:
Die
hier beschriebene Stromversorgung der weißen
Hintergrundbeleuchtung ist
mit der Ansteuerung der andersfarbigen Hintergrundbeleuchtungen
kompatibel und kann dort zu irreparablen Schäden führen!
Als Hintergrundbeleuchtung wurde das weiße Backlight-Panel gewählt:
|
|
Bildquelle: Electronic Assembly |
Diese
ist jedoch mit > 9,6 Volt (Forward voltage) zu betreiben. Das
ist mit dem Raspberry direkt aber nicht möglich.
Also mußte
ein DC/ DC Spannungswandler her. Gewählt wurde der Typ
AM2S-0512SZ vom aimtec.
Dieser ist recht klein , hat 4
Anschlüsse und macht aus 5 Volt Eingang eine Ausgangsspannung
von ca. 12 Volt mit gut 160 mA.
|
|
Links
ein (selbst erstelltes) Bild des Spannungswandlers |
Der Wandler hat die folgenden elektrischen Werte:
|
||||||||||
|
Der Hersteller hat sich auf Anfragen zur Veröffentlichung von Bild und Auszug aus dem Datenblatt auch nach über einem Jahr leider nicht zu irgendeiner Antwort entschließen können. |
||||||||||||
Auch die Beschaltung ist sehr einfach
|
|
Der
'+V input' Eingang [2] des Wandlers ist über die Induktivität
direkt mit 5,0 Volt des Raspberry verbunden. Die zusätzlichen Vorwiderstände als Strombegrenzung für die LED-Ketten sollten allerdings nicht vergessen werden (je ca. 180 Ohm)!
|
JA,
im Datenblatt steht, das Panel sollte mit einer Stromquelle
betrieben werden, aber die hier vorgestellte Version funktioniert
bei mir seit mehreren Jahren einwandfrei. Das schließt
aber
nicht aus, daß durch die hier gezeigte
Beschaltung
die Lebensdauer des Panels beeinträchtigt werden könnte!
Damit
die LED-Beleuchtung nicht immer leuchtet und bei Bedarf
abgeschaltet werden kann, wurde noch ein MOSFET als Schalter in
den Massezweig der Eingangsspannung zum Spannungswandler (-V
input) integriert.
|
|
Links ein Bild des MOSFET.
(Sony Xperia
Compakt mit 21MegaPixel und viel Zeit und GIMP) |
Hier ein paar elektrische Werte aus dem Datenblatt:
|
||||||||||
|
Der Hersteller hat sich auf Anfragen zur Veröffentlichung von Bild und Auszug aus dem Datenblatt auch nach über einem Jahr leider nicht zu irgendeiner Antwort entschließen können. |
||||||||||||
Der MOSFET schaltet bereits bei niedrigen Gate-Source-Spannungen sicher und hat einen sehr geringen Durchlaßwiderstand.
|
|
Das Gate wurde über einen 1 kOhm Sicherheitswiderstand willkürlich auf den GPIO-Pin 18 gelegt. Source ist direkt mit Masse verbunden. Drain liegt am Eingang -V input [1] des Spannungswandlers. Auf eine PCM-Steuerung des MOSFET zur Helligkeitseinstellung wurde bewußt verzichtet, da sich bei einem anderen Projekt herausgestellt hat, daß unregelmäßige PCM-Pulse abhängig von der Prozessorlast teilweise ein unschönes Flackern verursachen. |
Da das
Display ohne PC und Tastatur bedient werden sollte, mußte nun
noch eine Eingabeeinheit her.
Diese bestand ursprünglich
nur aus einem einzigen Miniaturtaster und steuerte über
unterschiedlich lange Tastendrücke die einzelnen Funktionen.
Diese Einzeltaste hat sich dann aber als unpraktisch
herausgestellt.
Hier die endgültige Schaltung:
|
|
Inzwischen
besteht die Eingabeeinheit aus 2 Kurzhubtastern, die
einerseits direkt mit Plus 3,3 Volt des Raspberry und auf der
zweiten Seite über je 1 kOhm Schutzwiderstände mit den
GPIO-Pins 07 und 12 verbunden sind. |